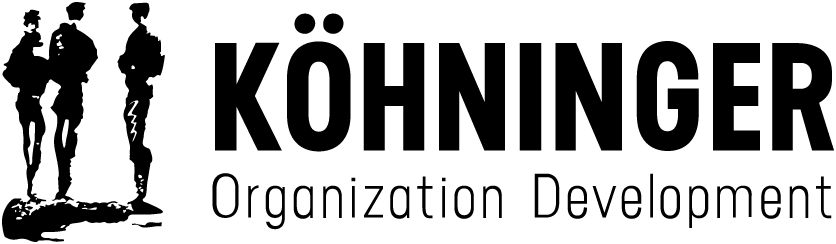Change the
Change
Hans-Joachim Gergs
Update fürs Veränderungsmanagement
Was ist heutzutage die wichtigste Unternehmenskompetenz? Ganz gleich, welchen Managementexperten man fragt, in welcher aktuellen Veröffentlichung man nachschlägt oder bei welcher Unternehmensberatung man anklopft, die Antwort wird mit hoher Wahrscheinlichkeit so oder ähnlich ausfallen: die Fähigkeit, sich schnell auf veränderte Umweltanforderungen einzustellen. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen den Common Sense: Denen zufolge sind die Unternehmen, denen das am besten gelingt, die sich kontinuierlich an ihre Umwelt anpassen, sich sozusagen fortlaufend selbst erneuern, mittel- und langfristig am erfolgreichsten. Diese Unternehmen sind jedoch nicht nur außerordentlich erfolgreich, sondern auch äußerst selten. Das Gros der Unternehmen tut sich mit der fortlaufenden Anpassung sehr schwer. Vordergründig ist das Problem vor allem ein strukturelles: Die meisten der heutigen Unternehmen wurden nach den Theorien und Konzepten der Pioniere des Managements wie Frederick Taylor, Alfred Sloan und Henry Ford entworfen – und die sind alle auf Stabilisierung und Standardisierung ausgerichtet, und nicht auf Veränderungsfähigkeit. Doch Strukturen lassen sich – in der Regel sogar vergleichsweise einfach – ändern.
Was sich dagegen schwer verändern lässt, sind Überzeugungen und Werthaltungen. Und genau da liegt der Hase tatsächlich im Pfeffer. Die klassischen Vorstellungen, die über Change kursieren und die seit Jahrzehnten von den Change-Experten bis hin zu den großen Managementvordenkern wie John Kotter, Ross Kanter und Noel Tichy verbreitet werden, sind mit dem Konzept der kontinuierlichen Erneuerung nicht zu vereinbaren. Doch nur weil etwas in der Vergangenheit erfolgreich angewandt wurde, ist es nicht zwangsläufig auch für die Zukunft angemessen. Vier der wohl verbreitetsten Überzeugungen des Changemanagements lassen sich angesichts neuerer Forschungsergebnisse kaum mehr aufrechterhalten.
Bei ihnen handelt es sich somit um Mythen, wenn man es etwas dramatisch mag, könnte man sie als die vier großen Mythen des klassischen Changemanagements bezeichnen. Dramatisch sind sie in jedem Fall in ihrer Wirkung. Denn letztlich sind eben vor allem sie es, die es vielen Unternehmen so schwer machen, mit der Dynamik und Komplexität der Märkte Schritt zu halten. Sie sind es, die kontinuierliche Erneuerung verhindern. Höchste Zeit also, sich von ihnen zu verabschieden.
Mythos 1: Grundlegende Veränderungen können nur dann erfolgreich sein, wenn es eine Krise gibt, die Handlungsdruck erzeugt.
In sehr vielen Lehrbüchern zum Thema Changemanagement findet sich eine Formel, die auf die amerikanischen Organisationsentwickler Richard Beckhard und Reuben Harris zurückgeht: D x V x F > R. „D“ steht für „Dissatisfaction“ mit dem Status quo, „V“ für Vision und „F“ für „First Steps“ zur Realisierung der Vision. Nur wenn das Produkt aus D, V, und F größer ist als R („Resistance“) besteht laut Formel die Möglichkeit einer Veränderung. Ist einer der Faktoren null, ist der gesamte Term null und kann damit niemals größer als R sein. Bedeutet: Damit Veränderung überhaupt stattfinden kann, müssen die betroffenen Menschen eine Not sehen, die es zu wenden gilt – eine Notwendigkeit. Diesem Gedanken folgend weist etwa Kotter in seinem millionenfach verkauften Buch „Das Prinzip Dringlichkeit“ auf die Bedeutung der Defizit-Analyse zu Beginn eines Veränderungsprozesses hin. Die Unternehmensführung müsse eine externe Bedrohung für das Unternehmen identifizieren und diese auch deutlich darstellen. Gelingt dies nicht, ist laut dem Managementvordenker der Prozess zum Scheitern verurteilt. Andere Autoren sprechen davon, dass es eines „Case for Action“ bedarf – beispielsweise eines unzufriedenen Kunden oder Mitarbeiters oder einen neuen Wettbewerber – irgendetwas eben, das Leidensdruck erzeugt. Keine Änderung ohne Leidensdruck. So oft diese Überzeugung wiederholt wird, so lange ist sie schon widerlegt. Bereits in den 1960er-Jahren haben die Organisationsforscher Richard Cyert, James March und der spätere Nobelpreisträger Herbert Simon Unternehmen analysiert und beschrieben, in denen Wandlungsprozesse nicht durch Krisen angestoßen wurden, sondern anscheinend wie von selbst in Zeiten guten wirtschaftlichen Erfolgs ins Rollen kamen. Was sie schließlich als Motor der Veränderung identifizierten, nannten sie „Slack“, zu Deutsch Schlupf, Puffer oder Überschuss. Dieser Überschuss kann sich auf Finanzen, Personal und Know-how beziehen und ermöglicht es Unternehmen, Risiken einzugehen und zu experimentieren. Wenn es Spielräume bei den Budgets gibt, kann in (Change-)Projekte investiert werden, die sich „nur“ langfristig, dafür aber eventuell umso stärker rechnen. Wenn das Alltagsgeschäft die Mitarbeiter nicht bis zum Anschlag fordert, bleibt geistige Kapazität, um zu erkennen, wie Dinge besser laufen könnten, und die Zeit, Neues zu lernen. Und wenn Mitarbeiter nicht nur das lernen, was sie unmittelbar für ihre aktuelle Arbeit brauchen, sondern sich sozusagen auch links und rechts weiterbilden, werden sie unter Umständen Entwicklungschancen sehen, die bislang niemand auf dem Schirm hatte, und entsprechende Veränderungen anstoßen. Damit Slack solche positive Wandelwirkung entfalten und eine Organisation letztlich in den Modus der kontinuierlichen Erneuerung kommen kann, braucht es eine grundlegend andere mentale Haltung zu Wandel und Veränderung bei den Führungskräften wie auch den Mitarbeitern. Im Unterschied zur Defizitorientierung, die man nach wie vor in der Mehrzahl der Unternehmen vorfindet, braucht es eine starke Neugier auf Zukunftschancen und die Potenziale des eigenen Unternehmens. Diese speist sich vor allem aus vier Einstellungen: Denken in Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen; Denken in veränderbaren Welten, Gestaltungs- und Handlungsspielräumen; Denken in positiven Signalen und Richtungen und Denken in Stärken. Auch wenn über dieses Mindset und dessen einzelne Facetten schon viel geschrieben wurde, besteht hinsichtlich dessen Entwicklung nach wie vor erheblicher Nachholbedarf. Die zentrale Aufgabe des Managements auf dem Weg zur kontinuierlichen Erneuerung wiederum ist es, Bilder möglicher Zukunftsszenarien zu zeichnen, die bei den Mitarbeitern positive emotionale Anspannung und Begeisterung wecken und sie so zum Mitgestalten bewegen. Die meisten Mitarbeiter wünschen sich nämlich, für ein Unternehmen zu arbeiten, dass der Entwicklung stets voraus ist, das Kreativität begrüßt und Erfindungsreichtum fördert. Sich mit der Zukunft zu beschäftigten macht Spaß, wenn man dazu die nötigen Freiräume hat. Genau hier liegt auch die psychologische Fehlannahme, die dem ersten Mythos des klassischen Changemanagements zugrunde liegt. Der amerikanische Organisationsforscher Peter Senge formuliert und korrigiert sie so: „Menschen wehren sich nicht gegen Veränderungen, sie wehren sich dagegen, verändert zu werden.“
Mythos 2: Tiefgreifende Veränderungsprozesse müssen schnell und mit radikalen Einschnitten in die Organisation betrieben werden.
Fast alle Theorien und Konzepte zu Veränderungsprozessen, die Organisationswissenschaftler und -berater in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben, basieren auf dem Konzept des episodischen Wandels. Dessen Grundgedanke: Organisationen befinden sich in einem Gleichgewichtszustand, der unterbrochen werden muss, damit sie sich verändern. „Unfreeze, change, refreeze“ hat der Sozialwissenschaftler und Begründer der Organisationsentwicklung Kurt Lewin in seinem Drei-Phasenmodell die dazugehörigen Schritte genannt, die einen Weg des schnellen, radikalen unternehmerischen Wandels beschreiben. Wirklicher Wandel funktioniert nur als großer Wurf, nachzulesen in den Change-Klassikern von Noel Tichy, David Nadler und Moss Kanter. Die Managementpraxis hat das episodische Modell des Wandels bereitwillig aufgenommen. In den allermeisten Unternehmen wird Change als Stop-and-go-policy nach dem Modell des lewinschen Dreisprungs betrieben. In den allermeisten Fällen kommt dabei allerdings nur ein kleiner Hüpfer (auf der Stelle) heraus. Bereits Mitte der 1990er-Jahre kam Harvard-Professor Kotter – übrigens ebenfalls ein Verfechter der Idee des episodischen Wandels – in einer Studie zu dem Ergebnis, dass mehr als 70 Prozent aller Veränderungsprojekte scheitern. Neuere Untersuchungen bestätigen diese schlechte Erfolgsquote von unter 30 Prozent weitgehend. Drängt sich die Frage auf, warum die klassischen Change-Programme so wenig erfolgreich sind. Ein Blick in die Natur gibt interessante Hinweise. Aus der Natur haben wir gelernt, dass Wandel kontinuierlich stattfindet ohne Anfang und Ende. Mutationen ereignen sich in der Natur ständig und nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten. Für die Natur sind stabile Zustände „uninteressant“, denn diese Zustände sind pathologisch. Das einzig biologisch wirklich stabile System ist tot. Während der natürliche Zustand Instabilität und Fließen bedeutet, versuchen wir in unserem ‚klassischen’ Denken über Organisation Instabilität nach wie vor auszuklammern. Wir vermeiden noch immer den Gedanken an wackelige Konstruktionen und instabile Systeme. Dass sich dieses natürliche Change-Muster auf die Unternehmenswelt übertragen lässt, zeigt Kathlen Eisenhart von der Stanfort University mit ihren Forschungen in der sich extrem schnell ändernden IT-Branche. Erfolgreich – und in der Regel auch nur auf Dauer überlebensfähig – sind dort laut der Wirtschaftswissenschaftlerin jene Unternehmen, die genau wie natürliche Systeme mit vielen kleinen Experimenten permanent die Zukunft erkunden. So erzeugen sie einen ruhigen Strom kreativer Unruhe in der Organisation. Ruhig ist er vor allem deshalb, weil die kleinen Schritte das große Risiko vermeiden und so von dem unmenschlichen Zwang befreien, sich nicht irren zu dürfen. Die ruhige kreative Unruhe ist die Basis für kontinuierliche Selbsterneuerung dieser Unternehmen. Diese Form der kontinuierlichen Veränderung ist jedoch für viele Topmanager in psychologischer Hinsicht wenig attraktiv. Wenn in der Organisation Wandel als „stille“ kontinuierliche Erneuerung betrieben wird, können sie sich nicht profilieren. Denn im Gegensatz zu klassischen Change-Projekten bietet dieser „stille Wandel“ Managern nicht die Möglichkeit, sich als erfinderisch, brillant kämpferisch oder gar heldenhaft zu präsentieren.
Mythos 3: Grundlegende Veränderungsprozesse müssen immer von der Spitze eines Unternehmens initiiert und umgesetzt werden.
Im Sturm muss der Kapitän auf die Brücke! In unsicheren Zeiten werden von Führungskräften Mut und Entschlossenheit gefordert. Teils getrieben durch ihr Umfeld, teils getrieben durch das eigene Ego, übernehmen Topmanager in der Mehrzahl noch immer die Verantwortung für Veränderungen selbst. Die nach wie vor gültige Grundüberzeugung lautet: Veränderungen müssen immer an der Spitze der Organisation beginnen. Der Weg des erfolgreichen Wandels verläuft von oben nach unten, er wird von der Spitze aus initiiert und umgesetzt. Dieses Top-down-Vorgehen hat jedoch einen Haken, der heute den in zunehmendem Maße notwendigen Wandel behindert. Die Vielfalt und Dynamik der technischen Entwicklung macht es den oberen Führungskräften mittlerweile unmöglich, alle Veränderungen im Auge zu behalten. Zudem kündigen sich Veränderungen zuallererst in der digitalen Welt, genauer gesagt in deren Netzwerken an. Kaum ein Topmanager hat jedoch die Zeit, sich durch Twitter, Facebook, Spotify und Co. zu klicken. Mithin erfährt das Topmanagement von relevanten Veränderungen oft zu spät– und zudem aus zweiter oder dritter Hand. Abgeschottet durch eine Vielzahl von Führungsebenen wird ihm die Wirklichkeit geschönt und vor allem stark reduziert präsentiert. Von oben organisierter Change ist daher mithin zunehmend zu spät dran und zielt obendrein oft haarscharf an den Anforderungen der Realität vorbei. Sinnvollerweise sollte Change heute entgegen der alten Überzeugung auch von der anderen Seite, also von unten, initiiert werden. Dieser Change des Changemanagements wiederum ist dann tatsächlich Aufgabe des Managements. An diesem ist es, im Unternehmen eine entsprechende Infrastruktur der Veränderung aufzubauen und zu pflegen. Seine Rolle ändert sich damit vom Treiber des Wandels zu dessen Sozialarchitekten. Kern dieser Infrastruktur können zum Beispiel Change Communities sein, wie sie der ehemalige Google-Cheftechnologe Jim Coughran konzipiert hat. Innerhalb derer entwickeln Mitarbeiter organisatorische Veränderungen und treiben diese selbst voran, wobei ihnen ihre Führungskräfte den Rücken freihalten. Es gilt „People support what they create“, Menschen unterstützen, was sie entwickeln. Die Kernfrage des Changemanagements lautet heute nicht mehr: Wie können Veränderungsprozesse gemanagt werden? Sie lautet vielmehr: Wie schaffe ich eine Organisation, die sich kontinuierlich selbst erneuert?
Mythos 4: Veränderungsprozesse müssen akribisch geplant und gemanagt werden.
Bereits der Begriff „Changemanagement“ suggeriert, dass Wandel von Organisationen geplant und gemanagt werden kann, ähnlich einem Bau- oder IT-Projekt. Die Geschichten über erfolgreiche Veränderungsprozesse, die in den Werken des klassischen Changemanagements erzählt werden, sind fast alle vom Glauben an systematische Planung, Steuerung und Kontrolle geprägt. Die großen Unternehmensberatungen nähren diesen Glauben mit Change-Studien, die im Kern immer zum gleichen Ergebnis kommen: Change wird immer wichtiger – und ist nach wie vor schlecht gemanagt. Spätestens seit den 1970er-Jahren sollte das eigentlich keine Nachricht mehr wert sein. Denn zu dieser Zeit hat die Sozialwissenschaft erstmals umfangreiche Forschungsbefunde vorgelegt, die die Planbarkeit des Wandels sozialer Systeme mehr als nur in Frage stellen. Laut diesen Studien folgt sozialer Wandel in aller Regel nämlich nicht den Zielen und Plänen der beteiligten Akteure. Zwar verfügt das Management von Unternehmen über mehr und komplexere Mechanismen zur Steuerung „ihres“ Systems. Doch nach wie vor ist ihre Steuerungsmacht in Veränderungsprozessen sehr begrenzt, wovon die vielen gescheiterten Change-Projekte Zeugnis ablegen. Wenn ein Veränderungsprozess wirklich tief greifend ist, dann betritt ein Unternehmen in diesem Prozess Neuland und Neuland muss bekanntermaßen erst vermessen werden, bevor es berechen- und planbar wird. Oder wie es ein preußischer General auf den Punkt brachte: „Kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind.“ Unternehmen, die die überholten Vorstellungen der Planbarkeit von Change bereits über Bord geworfen oder sie – wie es vor allem bei jüngeren Unternehmen der Fall ist – erst nie adaptiert haben, besitzen daher meist nur einen groben Plan oder besser gesagt eine grobe Zielvorstellung. Statt umfangreicher (Vorab-)Planungen ist für diese Unternehmen das unmittelbare Feedback auf Experimente und kleine Veränderungsschritte der Ausgangspunkt für die nächsten Schritte. Experimentelles Lernen bildet den Kern ihres Entwicklungsprozesses: Tu etwas – schau was passiert – ziehe Rückschlüsse daraus – und gehe den nächsten Schritt, lautet das Mantra, dem sie in die Zukunft folgen. Sie akzeptieren die Tatsache ihrer eigenen Unwissenheit und sind daher in ständiger Bewegung. Sie verfügen über Strukturen zur Änderung von Strukturen. Sie wissen: Der Prozess der Erneuerung ist nie abgeschlossen, sondern hat immer etwas Vorläufiges und Vergängliches. Die Dynamik der Erneuerung drängt immer weiter und kennt weder Anfang noch Ende.